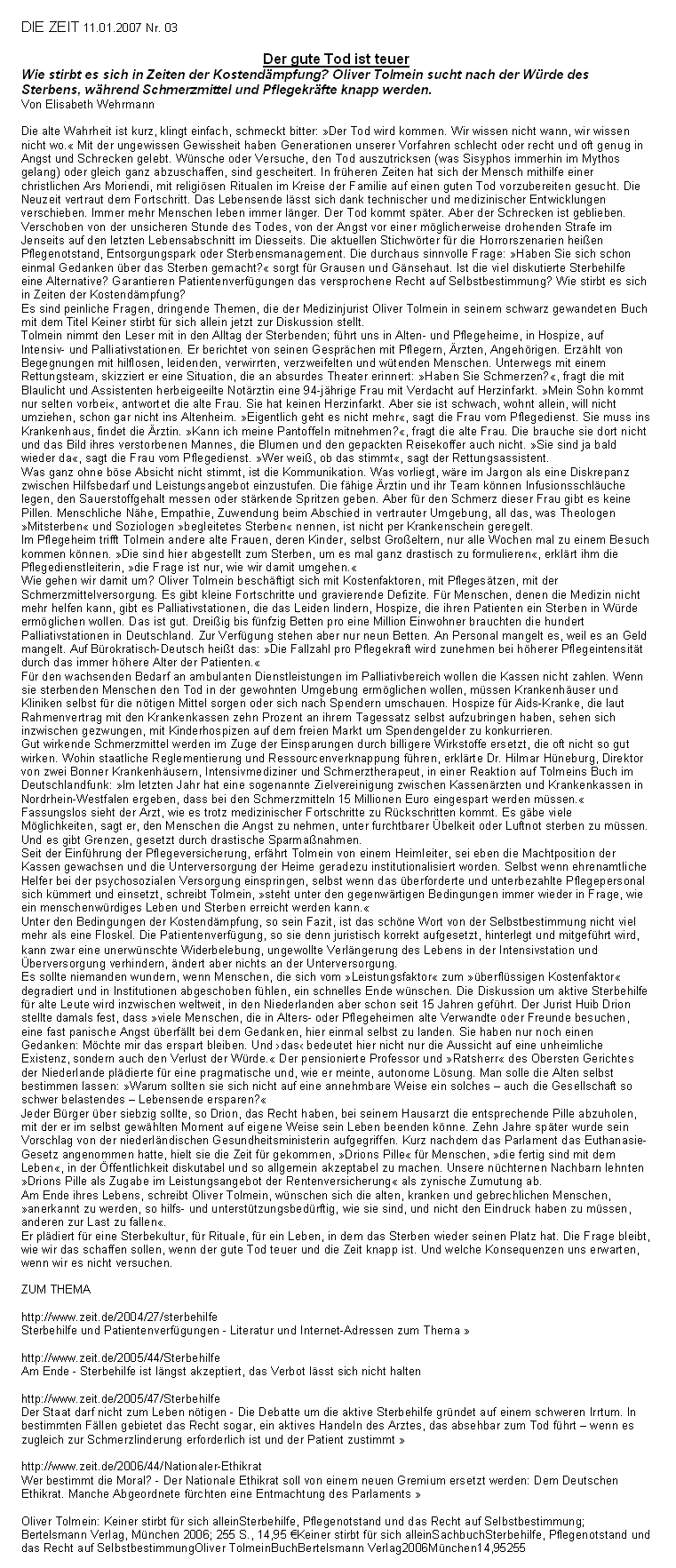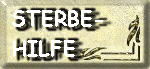

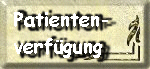

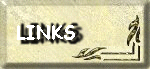
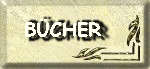
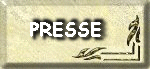
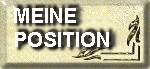
DIE REALITÄT


Schwester Elvira...
Auszug aus der ZEIT vom 27.4.2006
Was wäre wohl geschehen, wenn damals die Leiter nicht umgefallen wäre? Wenn sie allein wieder vom Kirschbaum heruntergekommen wäre, wenn nicht die Nachbarin der schreienden 97-Jährigen zu Hilfe hätte eilen müssen? Und wenn diese daraufhin nicht ins Heim eingewiesen worden wäre? Gut möglich, dass Theresa Hansen* dann zu Hause gestorben wäre, an die hundert Jahre wäre sie wohl alt geworden, und bei der Beerdigung hätte es geheißen, dass sie bis zuletzt eine rüstige Frau gewesen sei, wenn auch am Schluss etwas schrullig.
Nun liegt Theresa Hansen in einem der zwei Betten von Zimmer 404 im Haus Begonie, einem fünfstöckigen, schlichten Bau, der zum riesigen Gebäudekomplex des Hamburger Hospitals zum Heiligen Geist gehört. 103 Jahre ist sie inzwischen alt und immer noch kerngesund, wenn man von ihrem Gehirn absieht, dessen Verfall sie, so weit sich das von außen beurteilen lässt, auf das geistige Niveau eines Säuglings zurückgeworfen hat.
Manchmal schreit Frau Hansen tagelang, niemand weiß, warum, aber das Schreien verlängert ihr Leben, denn es hält die Atemwege intakt und die Lungenentzündung fern. Nichts spricht dagegen, dass sie auch ihren 104. und 105. Geburtstag in ihrem Bett in Zimmer 404 verbringen wird.
Hier aber soll es nicht um Theresa Hansen gehen, sondern um die Frau, die ihren mageren und verkrümmten Körper wäscht, ihr eine frische Windel umlegt, die ihr das Schmuseschaf in den Arm drückt, die Bettdecke aufschüttelt und bei all dem freundlich auf sie einredet. Elvira Pittelkau heißt diese Frau. Sie ist 54 Jahre alt, gelernte Krankenschwester, seit fünf Jahren stellvertretende Stationsleiterin im Hospital zum Heiligen Geist. Und sie ist, das sei, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, gleich gesagt, ein glücklicher Mensch. Dafür mag es verschiedene Gründe geben, aber einer davon ist ganz sicher ihre Arbeit....

Das lange Sterben des Walter K.
Wie der Wunsch nach einem würdigen Lebensende im Räderwerk von Krankenhaus, Pflegeheim und Gerichten untergeht
von Martin Spiewak
aus DIE ZEIT Nr. 17 vom 19. April 2001
Die holländische Entscheidung, die Euthanasie zu legalisieren, offenbart hierzulande einen eklatanten Gegensatz. Während Parteien, Ärzteverbände und Juristenvereinigungen das neue Gesetz der Nachbarn empört ablehnen, zeigen in Umfragen zwei Drittel der Bevölkerung Sympathie für die aktive Sterbehilfe. Ängstvoll fragen sich viele Patienten: Müssen sie am Lebensende sinnlose Schmerzen erleiden? Und wie behalten sie im modernen Medizinsystem die Kontrolle über ein menschenwürdiges Sterben? Eine klare Antwort erhalten sie von niemandem: Die Ärzte klammern sich oft an technisch Machbares, die Rechtslage ist umstritten (Seite 30), und auch eine Patientenverfugung hilft nur selten, wie das Schicksal von Walter K. zeigt
Im Zimmer riecht es nach Creme. Ein Radio spielt Klassik. Damit es nicht so still ist. Kann Walter K. die Musik hören? Er liegt unter einer Bettdecke, der Körper flach und hart wie ein Brett. Seine Fäuste stehen im 90-Grad-Winkel von den Armen ab. Zwischen den Fingern steckt ein Waschlappen, damit sich die Nägel nicht ins Fleisch graben. Die Nase ragt nach oben, den zahnlosen Mund hat Walter K. aufgerissen. Ein weißer Pelz bedeckt die Zunge. Mitunter stößt er röchelnd ein paar Laute aus. Wenn das Röcheln zum Brodeln wird, weiß die Schwester, dass sie Schleim absaugen muss.
Walter K.s Arme und Beine sind gelähmt, große Teile seines Gehirns sind zerstört. Nur ab und zu öffnet er die Augen und lässt sie in verschiedene Richtungen gleiten. Doch er atmet, und sein Herz schlägt langsam und gleichmäßig.
Schaltet man das Radio ab, hört man das Pumpen, das Walter K. am Leben hält. Über einen Schlauch drückt ein Motor Nahrung in seinen Körper. Eine milchkaffeebraune Masse fließt aus einem Beutel durch ein Loch in der Bauchdecke direkt in den Magen. Über einen zweiten Schlauch fließt Urin aus der Blase ab. 12 Kartons der kaffeebraunen Sondernahrungstehen im Schrank. Darüber liegen auf einem Bord fünf aufgeschnittene Polohemden. Sie sind das Einzige, was Walter K. noch braucht. Der Bürokalender neben dem Bett ist ohne Eintrag.
Walter K. hatte genaue Vorstellungen von den Dingen, den kleinen wie den großen. „Man muss aus seinem Leben etwas machen" hieß einer seiner Grundsätze. Eine gehobene Position in der Firma, 42 Ehejahre, vier Kinder, ein Haus mit Garten - Walter K. hat aus seinem Leben etwas gemacht. Als er vor fünf Jahren in Rente ging, wussten alle: Der bleibt jetzt nicht zu Hause sitzen. Jeden Morgen um sechs stand er auf und fuhr vor dem Frühstück mit seiner Frau zum Schwimmen. Zweimal im Jahr ging es in den Urlaub. Australien, Südafrika, USA, stets ohne Reisegruppe, alles minutiös geplant.
Ja, Walter K. war ein ordentlicher Mensch, der kluge Gedanken schätzte, Gefühlen misstrauisch gegenüberstand und nur ungern etwas dem Zufall überließ, im Leben wie im Sterben. Der Tod war ihm vertraut. Eine Freundin starb an Parkinson, eine Schwägerin an Krebs, die Schwiegermutter lag in den letzten Monaten ihres Sterbens im Koma. Seine eigene Mutter, ebenfalls von Krebs zerfressen, verbrachte ihre letzten Wochen nicht im Krankenhaus, sondern bei den K.s zu Hause.
Herr über seinen eigenen Tod zu sein, dieses Recht wollte auch Walter K. für sich in Anspruch nehmen. Deshalb verfasste er am 19. Februar 1999 eine Patientenverfügung und setzte seine Unterschrift unter folgende Sätze: „Für den Fall, dass ich unwiederbringlich nicht mehr in der Lage sein sollte, meinen Willen auszudrücken, verfuge ich im jetzigen Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass an mir keine sterbeverlängernden Maßnahmen durchgeführt bzw. bereits begonnene abgebrochen werden, sofern ich für den Rest meines Lebens unumkehrbar bewusstlos sein sollte." So hatte er es in der ZEIT gelesen.
Der Fall ereignete sich schneller als gedacht. Sechs Wochen danach, im Urlaub in Portugal, fand ihn seine Frau nachts auf dem Boden krabbeln und sich übergeben. Das Hotelpersonal dachte, er sei betrunken. Kurze Zeit später rührte er sich nicht mehr. Die Ärzte diagnostizierten eine Bewusslosigkeit als Folge einer Hirnhautentzündung. Doch die Patientenverfugung hat Walter K. bis heute nichts genutzt. Drei Prozesse wurden in der Sache K. gefiihrt. Vier medizinische Gutachten eingeholt. Walter K. aber darf nicht sterben.
Ehefrau Ellen K.
Am Anfang hatte sie noch Hoffnung. Ellen K. meinte, die deutschen Mediziner könnten mehr erreichen als ihre portugiesischen Kollegen. Nach ein paar Tagen nahm ihr ein Professor in der Universitätsklinik jede Hoffnung. Im Stehen zwischen Tür und Angel hob er ein paar Abbildungen des Gehirns ihres Mannes gegen das Licht, zeigte auf verschiedene dunkle Areale und sagte: „Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt." Walter K. leide unter einem apallischen Syndrom, auch Wachkoma genannt. Er werde wohl niemals wieder aus seiner Bewussdosigkeit erwachen.
In den ersten Tagen im Krankenhaus war noch von Rehabilitation die Rede gewesen. Dann hieß es nur noch, man müsse ein Pflegeheim finden. Eine Schwester warnte Frau K.: Geben Sie Ihren Mann nicht ins Heim, sagte sie, Sie bekommen ihn nie wieder heraus. ,Wir hörten nicht auf ihren Rat. Das war unser größter Fehler."
Als Frau K. das Schreiben ihres Mannes vorlegte, sagten die Ärzte, es zähle in diesem Fall nicht. Walter K. sterbe schließlich nichat, sondern brauche nur künstiche Ernährung. Dafür brauchten sie die Erlaubnis, eine Magensonde legen zu dürfen. Und wenn ich mich weigere? fragte Ellen K. Dann wird er eben über die Nase ernährt, sagten die Arzte. Das sei das Gleiche. Die Antwort war falsch, aber Frau K. wusste es nicht und gab ihre Unterschrift. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass sie sich übergangen, entmündigt, bevormundet fühlte. Behandlungen ohne Zustimmung, falsche Abrechnungen, nicht weitergegebene Arztbriefe. Vor kurzem wurde Herrn K. ein Stoppelhaarschnitt verpasst, um das Haarewaschen zu erleichtern. „Er hätte das nie gewollt", sagt sie. Und wenn er wüsste, wie Schwestern ihm manchmal die Wange tätscheln, wie einem Kind, sagt sie und schüttelt sich: „Er hätte sich geekelt."
Stets waren die K.s auf Unabhängigkeit bedacht, weder lagen sie jemals im Krankenhaus noch standen sie vor Gericht. Doch nun musste Ellen K. erleben, wie Ärzte, Pfleger, Richter über das Schicksal ihres Mannes entschieden und seinen wichtigsten Wunsch ignorierten. „Er wollte nicht so dahinvegetieren und hat das schriftlich bezeugt. Warum akzeptiert das niemand? Wie ist das möglich in einem Rechtsstaat?"
Jeden zweiten Tag besucht Ellen K. ihren Mann im Heim. Sie streicht ihm kurz über das Gesicht, schlägt die Decke zurück und schaut, ob er sich durchgelegen hat. Dann geht sie wieder. Nicht ein Foto hat sie auf den Nachttisch gestellt, statt Blumen steht Plastik in der Vase. Am Anfang hatte sie ihm seine Musik vorgespielt: „Benny Goodman und solche Sachen." Und ihr Parfüm mitgebracht. Doch er reagierte nicht, ebenso wenig auf Rufen und Streicheln. Nun hält sie ihm manchmal kurz die Nase zu, damit er wenigstens irgendetwas macht. Dann seufzt er auf. Meist bleibt sie nur kurz, oft nicht länger als zehn oder zwanzig Minuten. Eine Kontrollvisite, kein Besuch bei dem Mann, den sie geliebt, bewundert hat und mit dem sie 40 Jahre lang das Leben teilte. Der ist irgendwann in jenen Tagen nach dem 8. April 1999 in Portugal verschwunden.
Nur trauern kann sie nicht. Dafür wird sie bei jedem Besuch an seinen letzten Wunsch erinnert. Wie einen lebenden Vorwurf sieht sie ihren Mann dort liegen, der zu sagen scheint: „Du kannst meinen letzten Willen nicht erfüllen." Mitunter fleht sie zurück: „Bitte höre auf zu atmen."
Heimschwester S.
Zuerst habe sie Frau K.s Wunsch, dass ihr Mann sterben soll, nicht verstanden, sagt Schwester S. Warum lässt sie ihren Mann nicht in Ruhe weiterleben, habe sie gedacht, und genauso dächten noch immer viele im Haus. Aber dann hat sie mit Frau K. gesprochen und sie verstanden. „Heute wünsehe ich es ihm, dass er sterben kann." Doch zu diesem Können dürfe das Heim nichts beitragen. Wir machen nur die Pflege." Walter K. wird wie im Lehrbuch gepflegt. Er liegt auf einer beweglichen Luftmatratze, die Druckstellen verhindern soll. Alle zwei Stunden kommt eine Schwester ins Zimmer und legt ihn auf die andere Seite. Jedes Umbetten bezeugt sie mit einer Unterschrift, damit sie es nicht vergisst. Zweimal am Tag wird Walter K. gewaschen. Alle sieben Tage gebadet. Alle drei Tage bekommt er ein neues Morphiumpflaster, dreimal am Tag Tee und SN, Sondennahrung. So steht es auf einer Karteikarte, die an dem Pumpengerät hängt. 6 Uhr SN, 10 Uhr Tee, 13 Uhr SN, 16 Uhr Tee, 19 Uhr SN, 22 Uhr Tee. Dann ist der Tag vorbei.
Patientenverfügung — das Wort steht blau markiert auf Walter K.s Akte, für jedermann gut sichtbar. Auch Heimbesitzerin M. hat eine solche Ver-ügung geschrieben. ,Wenn man das so sieht, dass die gar nichts zählt, wenn man sterben will", sagt ie. „Das ist schlimm. Aber wir dürfen nichts machen."
Zurzeit liegt eine alte Frau im Altenheim, die sich vorgenommen hat, zu sterben, erzählt Schwester S. Sie isst nicht mehr und trinkt nicht mehr. Man habe versucht, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Vergeblich. Sie wollte nicht mehr. Jetzt tupfen die Schwestern nur ab und zu den Mund etwas feucht ab. ,Wir respektieren ihren Willen." Und wenn nun die Nachricht komme, auch Walter K. brauche nicht mehr ernährt zu werden? „Dann können wir Herrn K. nicht hier behalten", sagt Schwester S. und schüttelt den Kopf. Jeden Tag gehen die Schwester ins Zimmer, waschen und betten ihn, und irgendwann heißt es, er soll verhungern? Das gehe schließlich nicht sofort, dauert eine Woche, vielleicht zwei. Aber es war doch sein Wille? „Ja, aber wir müssen uns selbst schützen, wir haben auch eine Seele." Frau K. hätte ihn gleich vorn Krankenhaus nach Hause holen sollen. Aber nun, da er mal da ist... . Wir sind nur die ausführenden Organe."
Hausärztin L.
„Herr K. kann noch viele Jahre leben", sagt die Hausärztin. Er habe ein gutes Herz und einen stabilen Kreislauf. Vor ein paar Jahren hätte ihm seine robuste Natur nur wenige Monate genutzt. Patienten im Koma wurden mit einem Schlauch über die Nase ernährt. Zwangsläufig gerieten Bakterien in den Körper, es kam zu Infektionen, Lungenentzündungen. „Herr K. wäre längst tot."
Eine PEG-Sonde dagegen, wie sie Herr K. trägt, arbeitet keimfrei und komplikationslos. Früher wurden die Sonden zur so genannten Percutanen Endoskopischen Gastrostomie (PEG) nur im Krankenhaus eingesetzt. Heute findet man PEG-Patienten in fast jedem Altenheim. Vor allem Demente lassen sich per PEG nahezu problemlos ernähren. Über Jahre. Rund 100 000 Patienten bekamen 1999 eine PEG gelegt, mehr als die Hälfte ohne ihre Einwilligung. Für viele Wachkomapatienten bedeutet die Magensonde einen medizinischen Fortschritt. Einige tausend Fälle zählt man in Deutschland, und vor einigen Jahren dachte man noch, sie wären lebende Tote ohne Aussicht auf Besserung. Heute weiß man es besser. In mühevoller Therapie - durch Berührungen, Ansprache, Musik — versucht man mit den Apallikern Kontakt aufzunehmen. Ihre Rehabilitation ist schwierig und dauert lange. Doch mitunter gelingt es, sie Stück für Stück ins Leben zurückzuholen. Fortschritte sind vor allem bei jungen Patienten möglich, die nach einem Unfall ins Koma gefallen sind und sogleich behandelt werden. Solchen Kranken die PEG-Sonde wegzunehmen, bezeichnen Angehörige und Ärzte daher auch als Mord.
Walter K. ist 70 und besitzt solche Chance nicht mehr. Das hat das Gutachten einer Rehaklinik für Wachkomapatienten bestätigt. Große Teil seines Gehirns seien erloschen, die Augenbewegungen bloße Reflexe. „Das Letzte, was wir ihn wünschen, wäre, dass sich sein Befinden etwas verbessert, sodass er selbst merkt, in welchem Zustand er ist", sagt der Neurologe.
Für Walter K. bedeutet die PEG-Sonde ein Verlängerung seines Sterbens. Auf eine maschinelle Beatmung darf der Arzt verzichten, wenn sie nur das Leiden verlängern würde. Eine künstliche Niere darf er abstellen, wenn der Patient sterbenskrank ist und keine Besserung in Sicht ist. Denn passiv Sterbehilfe ist erlaubt und wird jeden Tag praktiziert. Die Magensonde jedoch zählt laut den Richtlinien der Bundesärztekammer nicht zur intensiv medizinischen Behandlung. Sie ist Hilfe zur Ernährung und gehört damit zur Basispflege, wie Waschen oder Betten. Auf sie hat jeder Patient, egal in welchem Zustand, ein Recht - und eine Pflicht.
,Wer die PEG abstellt, lässt den Patienten verhungern", sagt die Hausärztin. Wenn Walter K. eine Lungenentzündung bekommt, könnte sie darauf verzichten, Antibiotika zu geben. Wenn die PEG kaputt geht, würde sie dafür kämpfen, das keine neue gelegt wird. Wollte sie jedoch die künstliche Ernährung abbrechen, hat sie Angst, sich strafbar zu machen. Was also müsste geschehen? Frau K. müsste ihren Mann nach Hause holen, sagt die Ärztin. „Stirbt Herr K. dort, würde ich einer Teufel tun, beim Ausstellen des Totenscheins irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen."
Richterin N.
Einmal hat Frau K. es versucht. Im Herbst 199S kündigte sie an, sie wolle ihren Mann von jetzt ai zu Hause pflegen. Da rief das Heim das Amtsge rieht an. Im Eilverfahren entzog die Richterin ihr die Betreuung für ihren Mann. Es war die gleiche Richterin, die sich kurz zuvor geweigert hatte, den Abbruch der künstlichen Ernährung zu genehmigen. ,Wer gibt mir das Recht, zu entscheiden, ob ein Mensch leben oder sterben soll?", hat sich Richterin N. damals gefragt und, wie es sich für eine Richterin gehört, ins Gesetz geschaut. Die Antwort, die sie fand, hieß: Niemand.
Andere Juristen sind zur gegenteiligen Meinung gekommen - zum Beispiel jene des Bundesgerichtshofs. 1994 hatte der BGH im so genannten Kemptener Urteil über einen ähnlichen Fall zu entscheiden. Ein Sohn wollte die künstliche Ernährung seiner schwer hirngeschädigten Mutter einstellen lassen und verständigte sich damals mit ihrem Arzt, der Frau nur noch Tee zu geben. Der BGH hielt das Ansinnen für rechtmäßig.
Eine Behandlung dürfe auch dann abgebrochen werden, wenn der unmittelbare Sterbevorgang noch nicht eingesetzt habe. Wichtig sei allein der Wille des Patienten. Mit aktiver Sterbehilfe habe das nichts zu tun. Das BGH ging noch einen Schritt weiter: Selbst wenn keine Patientenverfügung vorliege, sei etwa ein Abbruch der Ernährung möglich, wenn der Patient zu Lebzeiten Ähnliches geäußert habe. Zu prüfen habe dies das Gericht, das auch sonst für Vormundschaftsfragen zuständig ist, in der Regel das Amtsgericht eben.
Das Urteil und seine Begründung waren ein Fanal im ewigen Streit zwischen Selbstbestimmungsrecht des Patienten und dem unbedingten Wert des Lebens. In der Praxis jedoch änderte sich nichts. Bis heute hat nur das Amtsgericht Oberhausen ein einziges Mal den Abbruch einer künstlichen Ernährung genehmigt. In allen anderen Fällen verhielten sich die Richter wie Amtsrichterin N.: Sie erklärten sich für nicht zuständig. „Es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, die letzte Schranke zu lösen."
Eine Rechtslücke also, die es im Interesse der Betroffenen zu schließen gilt, möchte man meinen. Doch davon will man beim zuständigen Ministerium in Berlin nichts wissen. Patienten hätten bereits heute das Verfügungsrecht über die letzte Phase ihres Lebens, sagt Justizministerin Herta Däubler-Gmelin. Was das Gesetz regeln müsste, sei geregelt. Die unausgesprochene Angst lautet: Jede Bestimmung, die explizit klärt, wer unter welchen Umständen über das Ende eines Lebens bestimmen darf, wäre ein Schritt in Richtung Holland. Gerichte, die nicht selbst die Entscheidung treffen müssen, sagen, man darf entscheiden; Gerichte, die entscheiden müssten, entgegnen, man dürfe es nicht; und die Politik behauptet, es gebe keine Probleme. Diese gegenseitige Blockade der Rechtsorgane scheint der Amtsrichterin N. jedoch nicht unrecht zu sein. Denn niemals könne man mit Sicherheit wissen, was Patienten wie Herr K. wirklich wollten. Als er die Patientenverfügung ausfüllte, sei er schließlich gesund gewesen. Außerdem lässt Walter K.s letzter Wille Raum für Interpretationen. Was heißt „sterbeverlängernde Maßnahmen"? Was meint er genau mit „unumkehrbar bewusstlos"? Die PEG-Sonde wird in der Verfügung nicht erwähnt. Vielleicht denkt er heute ganz anders darüber, vielleicht ist er ja glücklich", sagt Richterin N.
Wenn Frau K. solche Satze hört, hasst sie die Richterin.
Anwalt R.
Er hat den Fall Walter K. zur persönlichen Sache gemacht. Er hat medizinische Fachbücher gekauft, englische Aufsätze zu den Fortschritten der Neuromedizin kopiert. „Man sieht sich ja immer selbst da liegen", sagt Anwalt R. „Oder die Mutter oder den Vater."
Zwei vergebliche Verfahren hat er in der Sache K. angestrengt, erst vor dem Amtsgericht, dann vor dem Landgericht, das die Entscheidung der Richterin N. bestätigte. Er könnte in die nächsten Instanzen gehen, dort vielleicht ein Urteil erwirken, das beispielhaft ist und die Rechtsunklarheit beendet. Doch das hieße erneute Prüfungen, Anhörungen und Befragungen, weitere Gutachten. Zudem würde es bis zur Entscheidung Jahre dauern — ohne Garantie, dass die Richter in seinem Sinn entscheiden. „Wie Mediziner sind viele Richter verantwortungsscheu." Rechtsanwalt R. weiß das recht gut, denn er war 30 Jahre lang selbst einer.
Einen neuen Prozess will er Frau K. nicht zumuten. Stattdessen hofft er, die Sache „unauffällig zu lösen". Denn das Landgericht hat zwar das Urteil der Richterin N. bestätigt, Frau. K. jedoch wieder als Betreuerin eingesetzt. Sie sei am besten geeignet zu erwägen, heißt es in der Urteilsbegründung, ob es dem Willen ihres Mannes entspricht, die „künstliche Ernährung mittels Nahrungssonde einzustellen und ihn verhungern zu lassen." Ein Wink: Wir Richter können nicht entscheiden, die Ehefrau vielleicht. Anwalt R. hat sich erkundigt, wie so etwas in den meisten Fällen funktioniert. Die Ernährung wird langsam zurückgefahren, die Dosis Schmerzmittel erhöht. Nur ein Arzt muss mitspielen.
Vor kurzem wurde ein solcher Fall von dem Anwalt Wolfgang Putz erfolgreich durchgefochten. Ein Arzt hatte einer auf 26 Kilo abgemagerten Frau nach sechs Jahren Koma die PEG entfernt - im Einverständnis mit Angehörigen und Pflegeheim. Medikamente stellten die Frau schmerzfrei, nach sieben Tagen starb sie. Noch am Todestag erfolgte eine anonyme Anzeige. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Es habe sich nicht um eine Tötung gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Der Arzt habe nur dem Willen der Patientin entsprochen. Sein Handeln war nicht nur erlaubt, sondern geboten. ,Wir dürfen nicht fragen, ob wir aufhören dürfen, wir müssen fragen, ob wir weitermachen dürfen." So hat der Jurist Jochen Taupitz die Rechtslage auf dem Deutschen Juristentag des vergangenen Jahres zusammengefasst.
Die Debatte, ob man holländische Verhältnisse auch in Deutschland brauche, halten Juristen "wie Putz daher für überflüssig. Die Palliativmedizin und das deutsche Recht böten für alle denkbaren Fälle ethisch vertretbare Lösungen. Nur wissen es die wenigsten Ärzte, Pfleger, Patienten und Angehörigen - oder es fehlt ihnen der Mut. Auch Frau K. hat Angst und die Hausärztin ebenso. ,Wir werden beobachtet", sagt sie. Jemand könnte sie anzeigen. Eine Untersuchung würde folgen, eventuell ein Prozess. „Das stimmt", sagt Anwalt R. „Doch wahrscheinlich würde sie freigesprochen." Sicher wäre: Walter K. hätte seinen Willen.

Hoffnung für Patienten im Wachkoma
(kem) - „Hoffnung besteht für alle unsere Patienten", sagt Nicole Kohler vom Robert-Breuning-Stift, in dem es auch eine Wachkoma-Station gibt. Manche könnten nach der Reha sogar wieder sprechen oder im Rollstuhl sitzen. Nur ein Drittel aller momentan 23 Wachkoma-Patienten dämmerten schon so lange vor sich hin, dass die Chancen auf eine Genesung gering seien, sagt Nicole Kohler, Praxisanleiterin im Robert-Breuning-Stift. Dennoch mag sie nicht ausschließen, dass auch diese irgendwann aufwachen. Heißt: Kontakt zur Umwelt aufnehmen - sei es durch Sprache oder ein Augenblinzeln.
Die Patienten kommen immer dann ins Robert-Breuning-Stift, wenn sie die „Akut-Phase" überstanden haben. Das bedeutet, dass ein Ärzteteam im Krankenhaus die intensivmedizinische Behandlung bereits abgeschlossen hat, das Herz-Kreislauf-System stabil ist. Auf der Station läge allerdings „keine klassische Altenheimklientel", berichtet Kohler. Die meisten Patienten würden entweder nach einem Unfall, einem allergischen Schock oder einem Schlaganfall eingeliefert. „Der Jüngste auf der Station ist 25 Jahre alt", so Kohler.
Patientenverfügungen lägen nur bei einem Teil der zu Pflegenden vor. „Bei einem Unfall hat schließlich nicht jeder eine Verfügung in der Tasche", erklärt die Praxisanleiterin. Dann sei es normal, dass die Mediziner alles unternähmen, das Opfer zu retten.
Und selbst wenn eine Verfügung vor der Operation vorgelegt werde, sei diese rechtlich nicht unbedingt bindend. Denn Ärzte könnten sich im Gegenzug auf ihren hippokratischen Eid berufen.
aus LKZ

„Fall Schiavo unmöglich in Deutschland"
(kern) - Das Verhalten der Ärzte im Fall von Margarete Groche nennt Rechtsanwalt Dr. Günter Zecher „unglücklich". Gleichwohl hätten die Mediziner die grundsätzliche Verpflichtung, Leben zu retten. Zecher, auf Patientenverfügungen und Vorsorgeregelungen spezialisierter Anwalt, legt den Medizinern ans Herz, sich auch in Extremsituationen ausgiebig mit Angehörigen oder dem Willen des Patienten auseinander zu setzen. Trotzdem dürfe sich ein Arzt theoretisch über eine Patientenverfügung hinwegsetzen. In der Praxis werde dies allerdings kaum geschehen.
Zu Schwierigkeiten komme es meistens nur dann, wenn lebensverlängernde Einzelmaßnahmen in einer Patientenverfügung nicht exakt aufgelistet seien. „Es ist immer besser, wenn auf dem Dokument steht, was im Notfall unternommen werden darf und was nicht", sagt Zecher.
Jeder solle sich beispielsweise fragen, ob er schon die Dialyse oder erst die künstliche Ernährung als lebensverlängernd betrachte.
Der Fall Terri Schiavo - die Amerikanerin starb, nachdem die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr über eine Sonde ausgesetzt worden war - wäre nach deutschem Recht nicht möglich, betont der Ludwigsburger mit Kanzlei in Ilsfeld. „Dazu hätte der Sterbevorgang bereits eingesetzt haben müssen", erklärt Zecher. Er kann sich aber durchaus vorstellen, dass die Rechtsprechung in der Bundesrepublik in dieser Hinsicht bald aufgelockert werde. Ihn hat bislang auch noch kein Angehöriger kontaktiert, um juristische Schritte einzuleiten, weil eine Patientenverfügung von Ärzten übergangen worden war.
aus LKZ

89-Jährige wird gegen ihren Willen mit lebensverrlängernden Maßnahmen behandelt
Margarete Groche wird nur durch künstliche Ernährung am Leben gehalten - gegen ihren Willen. Denn in einer Patientenverfügung hatte sie sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen ausgesprochen. Die Ärzte legten ihr dennoch eine Magensonde. „Besteht keine realistische Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens, möchte ich mein Leben in Würde vollenden", hatte Margarete Groche im Mai 2002 in einer Patientenverfügung festhalten lassen. Auf lebensverlängernde Maßnahmen sollten die Ärzte dann verzichten - taten sie aber nicht. Als die heute 89-Jährige im Mai 2003 nach einem Schlaganfall ins Koma gefallen war, versorgten die Ärzte in einer Klinik in Filderstadt Margarete Groche über einen Schlauch mit Nährstoffen, erzählt ihr Sohn Hartmut. Später legten die Mediziner ihr dann eine Magensonde, sagt der Bankdirektor verärgert. „Die Ärzte haben ein regelrechtes Horrorszenario darüber gezeichnet, wie meine Mutter leiden müsste, wenn sie weder Wasser, Medikamente noch Nahrung bekommt", so Hartmut Groche. Also habe er unter dem Druck der Mediziner und in der extremen Stresssituation seine Einwilligung zu den lebensverlängernden Maßnahmen gegeben.
Eine Entscheidung, die er und seine Frau Susanne Pfab-Groche heute zutiefst bereuen. „Meine Schwiegermutter kann das Haar ihrer Enkelkinder nicht mehr fühlen, sich nicht mehr kratzen, wenn es juckt und kein wohlriechendes Aroma mehr erschnuppern. Und dann behauptet George W. Bush zum Fall Terri Schiavo, sie habe ein Recht auf Leben", sagt Susanne Pfab-Groche. Sie hält es „für eine Perversion unserer Gesellschaft", dass ein solcher Aufwand für Todkranke betrieben werde - und versteht nicht, warum ihre Schwiegermutter so dahinsiechen müsse und nicht in Würde gehen dürfe. Mit „eine perfekt versorgte Hülle" beschreibt Pfab-Groche den Zustand ihrer Schwiegermutter. Den Pflegern im Kleeblatt-Heim in Affalterbach, in dem Margarethe Groche seit einigen Monaten untergebracht ist, macht das Ehepaar Groche dabei keinen Vorwurf.
Im Gegenteil: „Mit dem Heim und der Pflege dort sind wir absolut zufrieden", betont Hartmut Groche. Ihm fehlt hingegen das Verständnis dafür, „dass die Ärzte sterbenskranken alten Menschen eine Magensonde legen". Außerdem kritisiert er, von den Medizinern unter Druck gesetzt worden zu sein. Die Würde des Menschen rücke hinter die Frage des medizinisch Machbaren ins zweite Glied zurück. Doch was ist ein würdevolles Leben? Das müsse jeder selbst entscheiden, sagt Pfarrer Bernd Burgmaier von der evangelischen Friedenskirche in Bietigheim-Bissingen. Deshalb bezeichnet er sich als einen Verfechter von Patientenverfügungen. Darin sei eine klare Willensbekundung formuliert. Gleichzeitig hat der Pfarrer aber Verständnis für die Ärzte. „Auch die Kunst, mit moderner Medizin zu heilen, kann als von Gott gegeben interpretiert werden", betont er.
Christian Kempf
aus LKZ

Schwierige Lage, schwieriges Gesetz
In der Ausgabe vom 17. Oktober Ihrer Zeitung zitieren Sie die Bundesjustizministerin mit der Aussage, eine Debatte über das Thema „Aktive Sterbehilfe" entspreche in Deutschland nicht den Bedürfnissen der Menschen. Ich will Ihnen mal mein persönliches Schicksal schildern: Ich leide an den Folgen eines Schlaganfalls (1999) und einer inkompletten Querschnittslähmung (2004), bin amtlich 100 Prozent schwerbehindert, an den Rollstuhl gebunden, den ich aber wegen der geschädigten Beine und Arme kaum mit eigener Kraft, schon gar nicht außerhalb meiner Wohnung bewegen kann, bin auf eine Betreuung „rund um die Uhr" angewiesen, da ich mich weder selbständig waschen, an- oder auskleiden noch ohne Hilfe den Toilettengang absolvieren kann. Mit all diesen Handicaps und Defiziten kann ich leben, auch mit einem jahrzehntealten Diabetes und einem lästigen Dekubitus und mich darauf in einer mir, Gott sei Dank, gegebenen verständnisvollen Umgebung einstellen.
Was mir aber schier die Sinne raubt, sind irrsinnige neuropathische Schmerzen im ganzen Körper, tagsüber und vor allem nachts, und ständige Harnweginfekte. Die Medizin kommt an die Ursachen dieser Beschwerden nicht heran, kann nur Einfluß nehmen auf die Symptome im Rahmen einer Schmerztherapie mit Psychopharmaka, Morphinen oder - im Falle der Harnweginfekte - mit einer Dauerbehandlung mit Antibiotika. Aber was für Nebenwirkungen haben all diese Medikamente, die auf die Dauer auch noch abhängig machen? Benommenheit, Schläfrigkeit, Schwindel, Zittern, Unkonzentriert-heit, Verwirrtheit, nachlassende Aufmerksamkeit, Schwerfälligkeit, Reizbarkeit, Gedächtnisstörungen, Sprechschwierigkeiten, Übelkeit, Sehstörungen . . . nur um die häufigsten Nebenerscheinungen zu erwähnen; auf die Gefahr von Entgleisungen von Labor- und sonstigen Meßwerten wird hingewiesen und auf die Möglichkeit von gravierenden organischen Schäden. Natürlich kann man alle Nebenwirkungen wiederum medikamentös behandeln und die geschädigte Niere an ein Dialysegerät anschließen.
Aber was ist das für ein Leben?! „Satt und sauber" dahinzudämmern ... fünf, zehn oder fünfzehn Jahre lang, um dann irgendwann zu verenden. Ich bin siebzig Jahre alt, habe ein arbeitsreiches, erfolgreiches, erfülltes Berufsleben hinter mir, habe eine Fülle guter Erinnerungen an meinen bisherigen Lebensverlauf, einen großen Bekannten- und Freundeskreis, lebe mit meiner Korrespondenz und meinen geliebten Büchern, nehme teil - wenn auch nur rezeptiv - an allem, was in der Welt geschieht. Und das soll alles sukzessive in geistige Umnachtung verschwinden?'
Ich selber will aus freien Stücken über mein Leben entscheiden können und ausscheiden, wenn es mir unerträglich wird. Es gibt verfassungsmäßig ein Recht auf Leben, aber (noch?) keine Pflicht zu leben. Das wäre für mich ein Horror, inakzeptabel. Ich suchte eine Möglichkeit, in Würde und mit Anstand - auch aus Rücksicht auf meine Familie - mein Leben, wenn es denn sein muß, zu beenden, zu einem von mir gewählten Zeitpunkt. Diese Möglichkeit habe ich bei Dignitas (die im übrigen keinesfalls leichtfertig mit ihrem Hilfsangebot umgehen) gefunden. Seit ich die grundsätzliche Hilfszusage habe, lebe ich in großer Gelassenheit, Leichtigkeit und bringe mich mit großem Einsatz in verschiedene Therapien ein, um vielleicht doch die eine oder andere Fertigkeit wiederzugewinnen. Ein gesunder Mensch kann sich nicht vorstellen, welche Pein der ständige Gedanke an Freitod als einziger Ausweg aus einer unerträglichen Situation verursacht, er vergiftet den ganzen Körper und beherrscht alle Sinne, wenn eine Lösung nicht in Sicht ist.
Ich würde mir etwas mehr Sachlichkeit und Objektivität und eine sorgfältigere Behandlung dieses komplizierten und zugegebenermaßen heiklen Themas wünschen; vor allen Dingen erwarte ich das von der Legislativen. Ich weiß, daß das von mir für mich geforderte Recht auf Selbstverantwortung und Selbstbestimmung nicht dem vorherrschenden Zeitgeist in unserem Land entspricht und ein solches Anliegen auch höchst schwierig in eine Gesetzeslage umzusetzen wäre und dies für sicherlich gottlob nur eine kleinste Minderheit in unserem Land. Das Thema deswegen aber für tabu zu erklären oder als solches zu negieren ist unredlich.
Meinhard Carstensen, Hamburg
aus FAZ vom 1.11.05

Getötet werden statt Selbsttötung
Zur Diskussion über die aktive Sterbehilfe (zum Beispiel F.A.Z. vom 17. Oktober): Ich bin 91 Jahre alt und kenne viele alte Menschen, die mit unerträglichen Schmerzen leben und die lieber heute als morgen aus dem Leben scheiden möchten. Für mich grenzt es an einen Skandal, daß die Politik diesen bedauernswerten Menschen nicht längst einen Weg gezeigt hat, der zu einem schmerzlosen Abschied aus dem Leben führt. Die gleiche Gesellschaft, die es jungen Frauen erlaubt, keimendes Leben in ihrem Körper zu töten, versagt es alten, leidenden Menschen, ihr Leben zu beenden. Heute sterben deshalb mehr Menschen durch Selbsttötung (diffamierend „Selbstmord" genannt) als durch Verkehrsunfälle. Von den etwa 13 000 Menschen, die sich jährlich in Deutschland umbringen, sterben die meisten, weil sie ihre chronischen Schmerzen nicht ertragen können und wissen, daß es keine Besserung gibt.Sicher wäre es ein guter Weg, leidenden, hoffnungslosen Menschen einen humanen Ausstieg aus dem Leben zu bieten. Wer nicht mehr leben kann oder will, dem sollte man den Ausweg der heimlichen Selbsttö tung durch humane Lösungen ersparen. Die segensreiche Hospizbewegung kann si cherlich manchen lebensmüden Menschen helfen. Wer aber diese Möglichkeit nicht nutzen möchte, dem sollte der Freitod nicht verwehrt werden. Warum wollen manche Moralprediger ausgerechnet alten, hilflo sen Menschen das Recht der Selbstbestim mung vorenthalten? In der Demokratie gibt es neben den Mehrheitsentscheidun gen auch den Minderheitenschutz. In der Frage der Sterbehilfe bestimmt im Grunde eine Minderheit, was die Mehrheit zu den ken, zu tun und zu unterlassen hat. Schlimm!
Gerhard Schröder, Kronberg/Taunus
aus FAZ vom 1.11.05

aus DIE ZEIT vom 27.10.2005
Ein Schlaganfall, eine Blutung im Stammhirn – zwei Jahre lang war Herr R. fast vollständig gelähmt. Andere Patienten kämpfen um ihr Leben, er kämpfte um seinen Tod
Von Frank Drieschner
Der Patient hatte sich seine Entscheidung gut überlegt. Nachdenken, das war das Einzige, was er noch konnte. »In Bezug auf den Suizidwunsch wurde der Patient befragt, wie viel Zeit er denn für die Realisierung seines Wunsches einzuräumen bereit sei«, notierte der Arzt. »Auf die Frage ›Eine Woche?‹ erfolgte promptes Kopfnicken, auf ›Zwei Wochen?‹ promptes Kopfnicken, auf ›Drei Wochen?‹ deutlich zögerndes Kopfnicken, auf ›Vier Wochen?‹ unzweifelhaft eindeutiges Kopfschütteln.« Außerdem registrierte der Arzt an dieser Stelle »ein bei aller eingeschränkten Beweglichkeit eindeutiges, flehendes Drängen mittels des rechtsseitigen mit geringer Kraft möglichen angedeutet ergreifenden und schüttelnden Händedrucks«.
Der Mann, der so dringend sterben wollte, hatte einen Schlaganfall erlitten. Eine Blutung im Stammhirn hatte ihn praktisch vollständig gelähmt. Den Kopf konnte er um »20–30 Grad nach rechts und je 10–20 Grad nach oben und unten« drehen, heißt es im Bericht des Arztes; der rechte Daumen war beweglich, das linke Auge ließ sich schließen und öffnen, das rechte stand immer offen. Menschen oder Dinge zu fixieren war ihm unmöglich, da seine Pupillen zitterten. Das Großhirn des Patienten aber war intakt; so war er bei vollem Bewusstsein im eigenen Körper eingeschlossen.
Locked-in-Syndrom: Alexandre Dumas hat dieses Krankheitsbild beschrieben, den »lebenden Leichnam« des Noitier de Villefort in der Geschichte des Grafen von Monte Christo. Aber erst die moderne Medizin mit ihren Methoden der künstlichen Ernährung hat aus einer qualvollen Art zu sterben eine qualvolle Art zu leben gemacht. Die Romangestalt Villefort wehrt Mordanschläge ab und stiftet eine Ehe; naheliegende Fragen zu den Körperfunktionen seiner Figur übergeht Autor Dumas gnädig. Im wirklichen Leben werden Locked-in-Patienten bisweilen so weit wiederhergestellt, dass sie Computer oder elektrische Rollstühle bedienen können. Manche können immerhin fernsehen. Es gibt, sehr selten, Verläufe, die einer Heilung nahe kommen. Und es gibt sogar den Fall einer britischen Patientin, die sechs Jahre lang bei vollem Bewusstsein für komatös gehalten und entsprechend behandelt wurde.
R. lebte seit zwei Jahren als »Eingeschlossener«. Eine nennenswerte Besserung, sagt sein Arzt, war praktisch ausgeschlossen. »Bei weiteren Besuchen nachdrückliche Bestätigung der Suizidabsicht«, notierte der Arzt. Und, wiederum einige Wochen darauf: »Verzweifeltes Drängen des Patienten auf eine Realisierung seines Lebensbeendigungswunsches.«
Wer darf sterben, wen darf man sterben lassen?
Von Zeit zu Zeit ruft diese Frage in Deutschland, nein, keine Debatte, eher eine Art öffentlicher Aufwallung hervor: im Frühjahr unter dem Eindruck des Prozesses um das Leben der US-amerikanischen Komapatientin Theresa Schiavo, gerade wieder, weil der Schweizer Sterbehilfeverein Dignitas angekündigt hat, in Hannover eine Niederlassung einzurichten (siehe Seite 5). Erkenntnisse haben diese Streitigkeiten bislang nicht zutage gefördert; sie dienen mehr der Bekräftigung ohnehin unverrückbarer Positionen als der Erörterung des Sachverhalts.
Neu ist diesmal immerhin, dass ein Politiker es wagt, öffentlich für Sterbehilfe einzutreten. »Der Staat hat den Wunsch eines Todkranken nach Hilfe beim Sterben uneingeschränkt zu respektieren«, sagte der Hamburger Justizsenator Roger Kusch (CDU) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Wagnis ist eine solche Meinungsäußerung, weil der Streit um das Ende des Lebens hierzulande allzu oft unter der Herrschaft eines allgegenwärtigen Faschismusverdachts geführt wird. Den CDU-Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe veranlasste sogar der Fall Schiavo, den der Rechtsstaat USA von Anfang bis Ende mit großer medizinischer und juristischer Sorgfalt behandelt hat, zu dem Vorwurf, hier gehe es um den »Einstieg in die Euthanasie schwerstbehinderter Menschen«.
Hunderttausende Menschen leben weiter – dank einer Magensonde
Weckt man damit nicht unbegründete Ängste, Herr Hüppe?
»Ich weiß nicht, ob diese Ängste unbegründet sind.«
Und meinen Sie mit Euthanasie, was die Nazis damit meinten, nämlich Mord?
»Es erschreckt mich schon, dass es so viele Parallelen gibt.«
Nämlich welche?
»Der Begriff des Gnadentods ist bei den Nazis immer mehr erweitert worden. Ich kann nicht völlig außer Acht lassen, dass dies eine Entwicklung war, die am Ursprung den Gedanken hatte, dass es unwertes Leben geben könnte.«
Wer Patienten auf eigenen Wunsch zu sterben gestattet, der bringt irgendwann auch Behinderte um? Eine ernsthafte Debatte über die Folgen des medizinischen Fortschritts fällt in Deutschland schwer. Im Fall der amerikanischen Komapatientin Schiavo lag das möglicherweise auch an der doppelten Illusion, es gehe nur um sehr wenige Menschen und diese könnten, was immer man mit ihnen anstelle, darunter nicht mehr leiden. Aber die entscheidende Frage betrifft eine große Zahl leidensfähiger und leidender Menschen: Was tun angesichts medizinischer Neuerungen, die keine Krankheiten heilen, aber natürliche Todesursachen eliminieren?
Wie Theresa Schiavo und der lebensmüde Locked-in-Patient verdanken allein in Deutschland Hunderttausende Menschen ihr Leben einer ziemlich trivialen Erfindung der achtziger Jahre, der so genannten PEG-Sonde. Sie wird durch die Bauchdecke in den Magen geführt und versorgt den Patienten mit Nahrung und Flüssigkeit. Bis zur Erfindung der PEG-Sonde war künstliche Ernährung eine heikle, unhygienische Angelegenheit, die nur zur Überbrückung von Krisensituationen taugte. Nun wurde es möglich, Menschen in den unterschiedlichsten Zuständen jahrzehntelang am Leben zu halten.
Die meisten PEG-Patienten sind bei vollem Bewusstsein. Andere sind bewusstlos wie Theresa Schiavo, dazu kommt die große Gruppe der Dementen in allen denkbaren Abstufungen des Dämmerns. Es gibt Patienten, die ihre Wünsche äußern können, andere, die es in der Vergangenheit getan haben, und solche, über deren mutmaßlichen Willen sich nur spekulieren lässt. Fast alle tragen die Sonden bis zu ihrem Tod. Gemeinsam ist ihnen, dass ihre Körper nicht durch Auszehrung geschwächt werden, auch dann nicht, wenn sie den Wunsch zu essen oder zu trinken längst nicht mehr verspüren, dass sie dank Antibiotika Infektionen in der Regel überstehen – und dass sie in einem Land leben, dessen Rechtsprechung den solchermaßen erschwerten natürlichen Tod gleichwohl für den einzig akzeptablen hält.
Patienten wie Herr R. sind zu totaler Untätigkeit verdammt
»Ich habe gleich gesagt, nehmen Sie das weg, mein Mann will das nicht«, sagt Frau R. Beweisen konnte sie das nicht, eine schriftliche Patientenverfügung hatte ihr Mann nicht verfasst. So kam es, dass R. vier Tage nach seinem Schlaganfall »nach komplikationsloser Anlage einer perkutanen Ernährungssonde« von der Intensivstation verlegt wurde, »in stabilem klinischen Befinden«, wie der ärztliche Bericht feststellt.
Inzwischen ist R. tot, man kann ihn nicht mehr fragen, wie es ihm in den folgenden Jahren ergangen ist. »Schlimm ist die Langeweile«, schrieb ein Mann, der ein knappes Vierteljahr als Eingeschlossener erlebt hat, ehe seine motorischen Fähigkeiten allmählich wieder zunahmen. »Der Locked-in-Patient ist zu totaler Untätigkeit verdammt. Eine der schlimmsten aller Strafen.«
Wenn Gegner der Sterbehilfe über den Wunsch zu sterben sprechen, pflegen sie die Alternative, nämlich weiterzuleben, als erfülltes oder jedenfalls gut erträgliches Dasein in der Obhut fachkundigen Pflegepersonals zu beschreiben. »Nicht durch die Hand eines anderen sollen die Menschen sterben, sondern an der Hand eines anderen«, warf Bundespräsident Horst Köhler gerade in die Debatte.
Die Wirklichkeit findet sich in den sachlichen Formulierungen des ersten repräsentativen Berichts über die deutschen Pflegeheime wieder, den die Krankenkassen vor einem Jahr vorgelegt haben. Seither weiß man, oder man kann es jedenfalls wissen, dass hierzulande jeder vierte Pflegeheimbewohner unzureichend vor Dekubitus geschützt wird, dem schmerzhaften Wundliegen, dass 120000 Menschen zu wenig Nahrung bekommen und mehr als 25000 Menschen als Folge der Vernachlässigung bereits gesundheitliche Schäden erlitten haben. Was der hilflose Locked-in-Patient R. in den folgenden Jahren erdulden musste, ist der normale deutsche Pflegealltag.
Für R. wurde das Liegen auf den immer gleichen Stellen, selbst bei regelmäßiger Umbettung schon eine Qual, durch die Nachlässigkeit des Pflegepersonals verschlimmert. Jeden Tag kam seine Frau in die Klinik, aber sie konnte nicht immer dort sein. »Wenn ich später wiederkam, lag er immer noch so da.« Niemand, der dem schwitzenden Patienten im Sommer eine dünnere Decke gegeben hätte. Niemand, der ihm den Schweiß von der Stirn wischte, damit er nicht in das ständig offene Auge floss. Niemand, der die Fliegen verscheuchte. Niemand, der das Radio abgestellt hätte, das die Putzfrau nach ihrer Arbeit einfach anließ. R. mochte Jazz und klassische Musik, die Putzfrau den Dudelsender WDR 4. »Das ist Folter«, sagt Frau R.
Dazu kamen die ständigen Erstickungsanfälle, weil der Speichel, den R. nicht mehr schlucken konnte, in seine Lunge floss und die Absaugeinrichtung nicht immer funktionierte. »Dann kam sein Auge fast aus dem Kopf«, sagt Frau R.
Hat es einen Sinn, ein solches Leben zu ertragen? Für R. nicht. »Mein Mann war Atheist, immer gewesen«, sagt seine Frau. »Ich auch.« Also sterben – aber wie?
Man täte Deutschland Unrecht, wollte man behaupten, dass es Menschen wie R. zwangsweise am Sterben hindere. Es gibt, jedenfalls theoretisch, zwei Auswege. Der eine, Suizid, ist für einen vollständig gelähmten Patienten praktisch nicht gangbar. Der andere ist die Verweigerung medizinischer Maßnahmen. Die Ernährung durch eine PEG-Sonde ist ein medizinischer Eingriff und darum nur mit Zustimmung des Patienten erlaubt. R. hätte darauf bestehen können zu verhungern oder zu verdursten, wobei es die Pflicht seiner Ärzte gewesen wäre, sein Leiden zu lindern.
R.s Arzt kennt sich mit den technischen Aspekten des selbstbestimmten Sterbens nach deutschem Recht aus. Er hat selbst Fachartikel über den Tod durch Flüssigkeitsentzug verfasst und eine Patientin, die diesen Ausweg gewählt hatte, im Sterben begleitet. »Ich konnte nicht mit letzter Sicherheit garantieren, dass er nicht leiden würde«, sagt er. Möglicherweise wäre ein solcher Tod für R. dennoch die bessere Wahl gewesen.
»Davor hatte er zu viel Angst«, sagt seine Frau.
R. hätte auch beschließen können, an einer Lungen- oder Harnwegsentzündung zu sterben, wie sie ihn von Zeit zu Zeit befielen. Dazu hätte er der Behandlung mit Antibiotika widersprechen müssen.
»Ich kann meinen Mann doch nicht an einer unbehandelten Lungenentzündung sterben lassen«, sagt seine Frau.
Im Fernsehen hatte sie einen Film über die niederländische Euthanasiepraxis gesehen. Ihr Sohn recherchierte im Internet und stieß auf die Schweiz mit ihrer Regelung für den begleiteten Freitod unter ärztlicher Aufsicht.
In Deutschland ruft die bloße Erwähnung des Sterbehilfevereins Dignitas gewöhnlich reflexhafte Ablehnung hervor. Dem Verein gehe es vor allem um »schnelles, effektives Sterben«, behauptete unlängst die niedersächsische Landesbischöfin Margot Käßmann.
R.s Ehefrau hat mit den Schweizer Suizidhelfern andere Erfahrungen gemacht. »Erst mal versuchen sie, einen davon abzubringen«, sagt sie. Der Schweizer Dignitas-Gründer, der Rechtsanwalt Ludwig Minelli, wurde in den folgenden Monaten ihr wichtigster Gesprächspartner. Jederzeit sei er für sie erreichbar gewesen, sagt Frau R., auch abends und am Wochenende. Und er habe darauf bestanden, mit ihr alle Alternativen zu einem Freitod ausführlich zu erörtern. Von Dignitas stammte auch das Formular für eine Patientenverfügung, die R.s Tod nach deutschem Reglement vorbereiten sollte, durch den Widerspruch gegen lebensverlängernde medizinische Behandlungen.
Aber R. hätte einen schnellen, schmerzlosen Tod unter Aufsicht eines Arztes vorgezogen. Und das ist mehr, als ein deutscher Patient verlangen darf.
Sogar das Recht, sich umzubringen, musste sich der eingeschlossene Patient R. erst erkämpfen. Zwar ist der Selbstmord und damit ebenso die Beihilfe zum Suizid auch in Deutschland straffrei – aber nur dann, wenn der Selbstmörder seinen Beschluss freiverantwortlich gefasst hat. Anderenfalls kann schon das bloße Geschehenlassen strafbar sein, wobei Ärzten und nahen Angehörigen besonders schwere Strafen drohen.
Ein Gutachter hatte R. ob seines Zustands kurzerhand eine »schwere geistige Behinderung« attestiert. Niemand, und am wenigsten ein Arzt, darf einem solchen Menschen gestatten, sich umzubringen. Frau R. gab ein Gegengutachten in Auftrag. Sie bestellte einen Notar ans Krankenbett. Hinterher hatte sie es schriftlich: »Nach Überzeugung des amtierenden Notars ist der Erschienene in der Lage, den Ausführungen zu folgen und die ihm gestellten Fragen hinsichtlich der nachfolgenden Patientenverfügung hinreichend zu beantworten.« Der erste Schritt war getan.
Mehr als 250 Deutsche sind in den vergangenen Jahren zum Sterben in die Schweiz gereist; schon ruft dieser »Sterbetourismus« dort Protest hervor, ein Grund, warum Dignitas nun auch in Deutschland arbeiten will.
Ein Problem blieb: Wie sollte der Gelähmte sich umbringen?
Für R., das war von vornherein klar, würde die Reise in die Schweiz eine Tortur werden. Einen Patienten, dem permanent der Speichel aus der Lunge gesaugt werden muss, kann man nicht mit einem einfachen Krankenwagen transportieren. R.s Glück war, dass seine ganze Familie sich um ihn kümmerte. Seine Tochter kannte einen Rettungssanitäter; er organisierte einen Notarztwagen.
Blieb ein Problem. Wie sollte der gelähmte Patient sich umbringen? Eine hohe Dosis Phenobarbitol bewirkt einen sanften Tod, die PEG-Sonde hätte das Gift in den Magen befördern können. Den Schalter aber musste R. selbst umlegen, auch in der Schweiz. »Zahlreiche Versuche der Ehefrau und beider erwachsener Kinder, eine Betätigung des Schalters der PEG-Pumpe mit der rechten Hand zu ermöglichen, scheiterten an der zu wenig kraftvollen, zu mangelhaft gezielten, zu hastigen Restbeweglichkeit«, notierte der Arzt.
»Er hat geübt, jeden Tag hat er geübt«, berichtet R.s Frau. Andere Patienten kämpfen um ihr Leben, R. kämpfte um seinen Tod. Und dieser Kampf war nicht aussichtslos. »Man hat das gemerkt, er konnte es schaffen.«
Für sie, das räumt Frau R. ohne Umstände ein, wäre der Tod ihres Mannes eine Erleichterung gewesen. Zwei Jahre lang hatte sie ihre gesamte Freizeit bei ihm verbracht und sich im Kampf mit dem Pflegepersonal aufgerieben. Sie ist darüber krank geworden, sie bekam einen Herzschrittmacher und entließ sich selbst aus der Klinik, um eher bei ihrem Mann sein zu können, den sie am liebsten keine Minute lang mit seinen Pflegern allein gelassen hätte.
Was für ein Kampf! In vielerlei Hinsicht standen R.s Chancen besser als die anderer Todeswilliger. Sein Arzt war auf seiner Seite. Seine ganze Familie kümmerte sich um ihn.
Am Ende hat R. seinen Kampf verloren. Die Reise in die Schweiz stand kurz bevor, als eine neuerliche Harnwegsinfektion ihm seine geringen Kräfte raubte. R. starb in einem katholischen Krankenhaus, in das er zum Schluss noch eingeliefert worden war, an den Folgen dieser Infektion und einer Lungenentzündung. Er war allein, als er starb, sein Tod muss schmerzhaft gewesen sein. Seine Frau wurde am folgenden Tag informiert.

aus DIE ZEIT vom 27.10.2005
Sterbehilfe ist längst akzeptiert, das Verbot lässt sich nicht halten
Von Wolfgang van den Daele
Die öffentliche Debatte, die in Deutschland über aktive Sterbehilfe geführt wird, ist soziologisch unterbelichtet. Politische Korrektheit verstellt den Blick auf die Tatsache, dass die Positionen der Entscheidungseliten sich immer stärker von den Wertvorstellungen der Bevölkerung entfernen. Während die Meinungsführer in Parlamenten, Parteien, Kirchen, Ärzteverbänden und Ethikkommissionen am Verbot der Tötung auf Verlangen ohne Abstriche festhalten, wächst in der Bevölkerung die Zustimmung dazu, dass kranke Menschen, die in aussichtsloser Lage den Tod herbeisehnen, ärztliche Hilfe zum Sterben in Anspruch nehmen können.
Die Zustimmung zu der Aussage »Ein schwer kranker Patient im Krankenhaus soll das Recht haben, den Tod zu wählen und zu verlangen, dass ein Arzt ihm eine todbringende Spritze gibt« ist zwischen 1973 und 2001 von 53 auf 64 Prozent gestiegen: Die Ablehnung hat sich fast halbiert von 33 auf 19 Prozent. Die Vorstellung, dass »ein Arzt einem unheilbar kranken Patienten auf dessen Verlangen hin ein tödliches Gift gibt«, empfanden zwischen 1990 und 2002 durchgehend knapp ein Drittel der Befragten als »sehr schlimm/ziemlich schlimm«, fast 70 Prozent dagegen »als weniger schlimm« oder »überhaupt nicht schlimm«. Danach würden etwa zwei Drittel der Bevölkerung aktive Sterbehilfe zumindest hinnehmen. Noch deutlicher ist die Ablehnung eines gesetzlichen Verbots der aktiven Sterbehilfe: 1990 waren zwei Drittel, 2000 fast drei Viertel der Befragten dagegen.
Es ist nicht zu erwarten, dass dieser Trend sich wieder umkehrt. Die Dynamik der Selbstbestimmung, die das Ethos moderner (westlicher) Lebensführung prägt, ist in unserer Gesellschaft ungebrochen. Davon zeugt etwa der gegenwärtige Wandel der Familienformen – von den Scheidungsraten bis zu den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Auch für Entscheidungen am Lebensende wird Selbstbestimmung eingefordert. Zwar wird auch in modernen säkularisierten Gesellschaften Menschen nicht einfach die Möglichkeit gegeben, sich selbst aus beliebigen Gründen umzubringen. Vielmehr wird der moralische Respekt, der dem Wert menschlichen Lebens allgemein geschuldet wird, auch auf Respekt vor dem Leben ausgedehnt, das man selbst verkörpert. Aber dieser Respekt gibt im Urteil der Bevölkerung eben dann der Selbstbestimmung nach, wenn jemand an schwerer, nicht heilbarer Krankheit leidet. Nur 12 Prozent pochen auch in diesem Fall auf die Heiligkeit menschlichen Lebens und halten daran fest, dass dieses keinesfalls vorzeitig beendet werden darf, »auch wenn der Patient das ausdrücklich verlangt«. Dagegen finden 70 Prozent, ein schwer kranker Mensch sollte »selbst entscheiden können, ob er leben oder sterben möchte«. Diese Einschätzung teilt auch die große Mehrheit der kirchlich gebundenen Menschen: 60 Prozent der Protestanten, 68 Prozent der Katholiken.
In Deutschland ist gegenwärtig an eine Freigabe der aktiven Sterbehilfe nicht zu denken. Mit der historischen Erfahrung der Euthanasie-Verbrechen der Nazizeit im Hintergrund gilt es als ausgemacht, dass jede Ausnahme vom Verbot der Tötung auf Verlangen schließlich der Tötung unheilbar Kranker gegen ihren Willen Tür und Tor öffnen würde. Die Alternative, solche Ausnahmen eng zu begrenzen und strikt zu kontrollieren, steht nicht zur Diskussion. Wer es wagt, sie unter Berufung auf die Wertvorstellungen der Bevölkerung ins Spiel zu bringen, setzt sich dem Vorwurf des »Populismus« aus – was jüngst der Hamburger Justizsenator Roger Kusch erfahren hat.
Allerdings ist eine Gesetzgebung, die an den moralischen Wertungen relevanter Teile der Bevölkerung vorbeigeht, auf die Dauer prekär. Mit Ausweichmanövern muss gerechnet werden. Die Hoffnung, den Problemen dadurch zu entkommen, dass man dem Wunsch nach aktiver Sterbehilfe durch mehr Palliativmedizin und bessere Versorgung in den Pflegeheimen den Boden entzieht, wird sich kaum erfüllen. Kranke Menschen, die in aussichtsloser Lage sterben wollen, haben nicht nur Angst vor unstillbaren Schmerzen. Sie haben vor allem Angst, in einem Zustand von Hilflosigkeit und Gebrechlichkeit zu enden, in dem sie jede Selbstständigkeit und damit nach eigenem Urteil ihre Würde und Individualität verlieren.
Wer sich in Deutschland dieser Perspektive durch Selbsttötung entziehen will, hat das Beispiel von Nachbarländern (Niederlande, Belgien, Schweiz) vor Augen, in denen aktive Sterbehilfe und organisierte Beihilfe zur Selbsttötung kontrolliert freigegeben sind. Er kann sich also notfalls der restriktiven deutschen Gesetzgebung durch »Flucht« ins Ausland entziehen – und dabei mit der stillen Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung rechnen.
Wolfgang van den Daele ist Mitglied des Nationalen Ethikrates und Direktor der Abteilung »Zivilgesellschaft und transnationale Netzwerke« am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

„Vorher jage ich mir eine Kugel in den Kopf
Über Sterbehilfe theoretisch zu diskutieren ist das eine - Etwas völlig Anderes ist es, wenn das Thema ins eigene Leben eindringt
Eine unheilbare Krankheit macht einen Mann zum Krüppel. Der will sterben, und seine gesunde Frau mit ihm. Der Sohn soll das alles organisieren. Erinnerungen. Wir veröffentlichen sie auf Wunsch des Autors ohne die Nennung seines Namens.
Mein Vater war kein guter Telefonierer. Deshalb musste schon die Tatsache, dass er mich überhaupt im Büro anrief, als Alarmzeichen gelten. Dann diese leise, tastende, fast zittrige Stimme, die wenig mit dem zupackenden, oft autoritären Menschen zu tun hatte, den ich so gut kannte. „Ich habe einen Tumor im Gehirn", sagte er nach kurzer Vorrede. Im Urlaub zwei Wochen zuvor war meinem Vater unvermittelt der Löffel in die Suppe gefallen, weil seine Hand ihm nicht gehorchte. Wir telefonierten nicht lange. Ich packte meine Sachen und fuhr die 300 Kilometer nach Hause. Vieles ging mir durch den Kopf, aber abgesehen von dem Gefühl einer dunklen Bedrohung hatte ich noch keine Ahnung, was auf mich zukam.
In spätestens zwei Wochen müsse er operiert werden, sagte der Arzt im Krankenhaus, um ihm überhaupt noch ein wenig Zeit zu verschaffen. In Wahrheit hatte mein Vater gar keine Wahl. Er fühlte sich gesund, ja äußerst fit für seine 62 Jahre, er wollte leben. Selbst wenn ihm jemand die Hölle, die vor ihm lag, plastisch hätte beschreiben können, hätte seine Ehefrau, meine Mutter, ihm die Freiheit zu sterben verwehrt. Die beiden waren, befördert durch ein traditionelles Rollenbild, über Jahrzehnte miteinander verwachsen. Er war der allumfassende Ernährer und Schützer der Familie bis hin zum Schriftverkehr mit der Krankenkasse. Ein Leben ohne ihn gab es für sie nicht.
Zu meinen schlimmsten Erinnerungen aus jener Zeit gehört der erste Besuch nach der Operation auf der Intensivstation. Die Mediziner hatten meinem Vater den Schädel geöffnet und den Tumor herausgeschnitten. Dabei mussten sie auch ein Stück Gehirn mitentfernen. Welches Gehirnareal wie betroffen sein würde, war im Vorhinein schwer zu sagen. Es würde schon gut gehen, es musste gut gehen. Mediziner übertreiben gerne bei den Nebenwirkungen, um sich abzusichern. Wer kennt schon jemanden, der auf Grund einer Narkose stirbt?
Meinem Vater wurde die Lebensfreude herausgeschnitten. Seine linke Körperhälfte funktionierte nicht mehr. Die Gesichtszüge ließen sich nicht kontrollieren, er konnte nicht das Bett verlassen, geschweige denn stehen oder gehen oder mit Messer und Gabel essen. Der Tumor, den sie ihm entfernt hatten, war aggressiv. Er würde wiederkehren. 18 Monate noch, vielleicht. Nie vorher oder nachher habe ich eine solche Verzweiflung gesehen wie damals in den Augen meines Vaters. Nicht der bevorstehende Tod war das Grausamste, sondern dass ihm der Krebs das nahm, was er im Leben liebte. Seine Frau war nicht mehr sie selbst seit jenem Tag. Sie verzehrte sich vor Sorge, Angst und Mitleid. Sie konnte nachts nicht schlafen und tagsüber den Mühen des Alltags kaum etwas entgegensetzen. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Naturmensch gewesen, Bergsteiger und Wanderer. Ließ das Wetter einen Ausflug gar nicht zu, pflegte er fast genauso leidenschaftlich sein zweites Hobby, die Schreinerei im Keller. Nun konnte er nicht mehr mit seinen Enkeln spielen, nicht mehr seinen sportlichen Wagen fahren, kein schönes Essen mehr genießen. Mein Vater hegte eine fast übertriebene Abneigung gegen Abhängigkeiten. Er war stolz, hasste es, Menschen verpflichtet zu sein, und pflegte sein Image als einsamer, durch die Wälder streifender Wolf. Jetzt konnte er sich nicht einmal mehr die Schnürsenkel binden. Er mochte keine Arztbesuche, keine Krankengymnastik und keine Pillen. Jetzt verging kein Tag mehr ohne medizinische Behandlung. Und dazu kam noch die Sorge um meine Mutter und die Angst vor dem Tod . Zu Hause rnachfe'Ser körperliche Zustand meines Vaters Fortschritte. Er konnte alleine aufstehen und ein paar Schritte gehen. Er konnte wieder sprechen und seinen Speichel kontrollieren, abefNjein LebensrfOit kehrte nicht zurück. Meine Mutter dagegen hätte auch in der Wüste auf einen Springbrunnen gewartet. So hoffte sie auf irgendeine Rettung, sei es durch ein Wunder oder ein neues Medikament, von dem sie im Krankenhaus gehört hatte. Er müsse nur durchhalten. Meine Schwester und ich standen irgendwo dazwischen. So absolvierte mein Vater die Strahlentherapie und die Chemotherapie, wurde wieder bettlägrig. Er verlor nun auch seine Haare. Dann lernte er wieder gehen.
Den Alltag mit einem todkranken Behinderten organisierten wir bald halbwegs erträglich. Jeder hatte seine Aufgaben. Mir war vor allem die Kommunikation mit den Ärzten zugefallen. Wir hatten Glück. Das behandelnde Krankenhaus, eine Spezialeinheit des Uniklinikums für Gehirntumoren, galt als einzigartig im weiten Umkreis. Ich fand sogar einen Arzt, mit dem ich von Mensch zu Mensch reden konnte. Lebensverlängernde Maßnahmen wurden ausgeschlossen, eine Patientenverfügung wurde veranlasse Nur das Wetter konnten wir nicht kontrollieren. Die sonnigen Tage waren die schlimmsten. Wortlos brütete mein Vater im Wohnzimmersessel. Selten wollte er hinaus, nur um sich zweihundert Meter die Straße hinauf- und hinunterzuquälen, immer in der Gefahr, die Kontrolle über sein linkes Bein zu verlieren und hinzuschlagen wie ein gefällter Baum. Wir redeten nicht viel miteinander in jener Zeit und kamen uns trotzdem nahe. Ich ahnte, was er litt, und konnte doch nichts anderes tun, als ihn mit leeren Worten zu trösten zu versuchen.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann er mich darum bat, ihm beirrt Sterben zu helfen. Früher hatten wir öfter darüber gesprochen, keinesfalls an Apparaten enden zu wollen, mit Magensonden im Schlund. „Vorher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf", pflegte er dann zu sagen - wie man das so sagt.
Jetzt konnte er sich nicht mehr selbst helfen. Sein Tumor wuchs wieder. Meine Mutter war zermürbt von der Pflege, dem Auf und Ab von Hoffnung und Enttäuschung durch die Therapien, der Düsternis meines Vaters und dem Schatten des Todes über dem Haus. Immer öfter wurde auch sie krank. Er hatte eine Entscheidung getroffen, er wollte wieder Herr der Lage werden. Dazu brauchte er mich. Ich sollte die Vorkehrungen treffen. Weder überraschte mich seine Bitte noch schockierte sie mich. Ich hatte auch keine moralischen Skrupel. Ich wusste, dass es das Richtige war, trotzdem schnürte mir Angst die Kehle zu. Ich würde mich nicht nur vor Gericht für eine Straftat verantworten müssen, sondern mir auch noch den Hass meiner Mutter zuziehen.
Denn mein Vater wollte sie nicht einbeziehen. In meiner Angst verfiel ich auf eine Idee, die ich auch heute noch nicht abschließend beurteilen kann. Ich übertrug meinem Vater die Verantwortung. Er solle so lange wie möglich durchhalten und dann den Zeitpunkt festlegen. Danach kaufte ich mir ein Buch über Selbstmord und entschied mich für die Methode Medikamentenmix plus Plastiktüte über den Kopf - man erstickt sozusagen sanft im Tiefschlaf. Einige Wochen später bat mich meine Mutter um Hilfe zum Selbstmord. Sollte mein Vater sterben, wollte sie nicht mehr leben, sagte sie. Ich wies ihr Ansinnen entrüstet zurück, und wir trennten uns im Streit, der lange unser Verhältnis beeinträchtigte. In meiner Not wandte ich mich an den Klinikumsarzt um Rat. „Wir können sie nur in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen. Aber dazu würde ich Ihnen nicht raten. Sie ist schließlich eine erwachsene Frau", sagte der Arzt. Wir ließen den Dingen ihren Lauf.
Mein Vater fragte mich nie wieder. Er legte keinen Zeitpunkt fest. Er wusste um die Nöte seiner Familie. Wir spielten eine Art Todesmikado, und er lag ganz unten. 18 Monate nach der Diagnose wurde er wieder ins Krankenhaus eingeliefert, kurz vor Weihnachten. Der Tumor hatte seine alte Größe übertroffen. Unser letztes Gespräch drehte sich um meine Mutter. „Soll ich ihr noch irgendetwas sagen?" fragte ich ihn. „Es gibt nichts mehr zu sagen", entgegnete er. Einen Tag später fiel er ins Koma, zwei Wochen später starb er in unserem Beisein. Beinahe als Wunder muss gelten, wie meine Mutter sich von Stund an der Realität gestellt, sich aus ihrer Agonie befreit und ein neues Leben aufgebaut hat. Vor Kurzem, fünf Jahre nach dem Tod meines Vaters, habe ich das Selbstmordbuch in den Müll geworfen.
aus Stuttgarter Zeitung vom 19.11.2005