

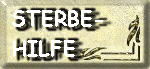

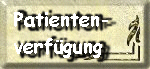

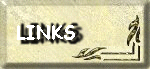
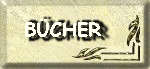
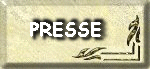
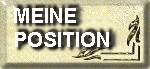
Schmerzbehandlung


Medikamente helfen, die Lebensqualität zu bewahren
Schmerzen können so unerträglich sein, dass die Betroffenen jede Freude am Leben verlieren. Der Wunsch nach dem Tod und der Erlösung von den Schmerzen wächst. Eine gezielte Behandlung aber kann die Qualen lindern und so das Leben - und Sterben - erträglicher machen.
Von Klaus Zintz
Migräne, kaputte Bandscheiben, abgenutzte Gelenke, ein Tumor samt Metastasen: die Ursachen für unaufhörliche, schlimme Schmerzen sind vielfältig. Die Folgen sind in jedem Fall fatal: Wenn Schmerzen nicht mehr weichen und damit chronisch werden, steht den Betroffenen ein Martyrium bevor. Dabei stellen chronische Schmerzen nach Ansicht von Experten für ältere Menschen die bedeutendste Krankheit dar: „Jeder zweite Mensch über 65 Jahre leidet in irgendeiner Form an chronischen Schmerzen." Das sagte Michael Zenz, der Präsident der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes, gestern zum Auftakt des 30. deutschen Schmerzkongresses in Bremen.
Die Schmerzbehandlung ist laut Zenz für Niedergelassene Ärzte wie für Kliniken ein Zuschussgeschäft. Zudem seien Hausärzte oft überfordert. Auch deshalb leide jeder chronische Schmerzpatient durchschnittlich zehn Jahre an Schmerzen und besuche in dieser Zeit zwischen fünf und 15 Ärzten, ohne dass ihm geholfen werde., Es liegt auf der Hand, dass solche „Schmerzkarrieren" Menschen zermürben - und schließlich den Wunsch nach dem Tod übermächtig werden lassen.
Bis zu 3000 Selbstmorde im Jahr
Angaben von Schmerzexperten zufolge begehen in der Bundesrepublik jährlich ungefähr 2000 bis 3000 Menschen mit chronischen Schmerzen Selbstmord. Und auch bei vielen Menschen, die an einer unheilbaren, schmerzhaften Krankheit wie etwa Krebs leiden, wächst ob dieser Schmerzen die Bereitschaft, dem Leben ein Ende zu bereiten -oder bereiten zu lassen.
Akute Schmerzen haben für den Körper eine Warnfunktion: „Etwas ist nicht in Ordnung, kümmere dich darum", lautet die Botschaft. Die Ursache muss erkundet und medizinisch behandelt werden. Doch wenn der Schmerz bestehen bleibt, sorgen Vorgänge im Körper dafür, dass die Schmerzen stärker werden, obwohl die Ursache gleich bleibt oder sogar bereits weggefallen ist. Die Fachleute reden dann von chronischen Schmerzen. Diese haben ihre Signal- und Warnfunktion weit gehend verloren - und sie können langsam aber sicher die Persönlichkeit der Betroffenen zerstören.
Zur Behandlung chronischer Schmerzen müssen, so betonen Experten immer wieder, Mediziner, Psychologen und Pflegekräfte zusammenarbeiten. „Zur erfolgreichen Therapie gehören nicht nur die Pille, die Spritze, die Massage oder der Psychologe, sondern von allem etwas", formulierte es der Bremer Schmerzmediziner Michael Strumpf, der den Kongress leitet. Das wichtigste Ziel einer solchen Behandlung ist, den Schmerz so weit zu verringern, dass der Patient damit leben kann - völlige Schmerzfreiheit kann bei chronischen Schmerzen niemand gewährleisten.
Der Patient steht im Vordergrund
Ähnliches gilt für die Behandlung todkranker Menschen mit starken Schmerzen. Um sie kümmert sich die so genannte Palliativmedizin - zumindest sollte sie es tun. Ihr Hauptziel ist nicht die Verlängerung der Überlebenszeit um jeden Preis, sondern die bestmögliche Wahrung der Lebensqualität. Dabei stehen weniger die medizinische Behandlung der Krankheitj sondern Wünsche, Ziele und Befinden des Patienten im Vordergrund.
So orientiert sich etwa die Betreuung von Krebskranken an der Stärke der Schmerzen. Bei leichteren Schmerzen wird mit Medikamenten behandelt, die nicht zu den so genannten Opiaten gehören. Es folgen verschiedene zu den Opiaten gehörende Wirkstoffe, bis schließlich bei den schlimmsten Schmerzen Morphin oder ähnliche Mittel verabreicht werden. Doch neben der Behandlung der Schmerzen und anderer körperlicher Symptome nimmt sich die Palliativmedizin zudem der psychologischen und - so erforderlich - sozialen Probleme nicht nur der Patienten, sondern auch der Angehörigen an.
aus: Stuttgarter Zeitung vom 21.10.2005
Den Schmerz beherrschen

Palliativmedizin
aus WikipediaNach der Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist Palliativmedizin die Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren, progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung die Lebensqualität ist. Nicht die Verlängerung der Überlebenszeit um jeden Preis, sondern die Lebensqualität, also die Wünsche, Ziele und das Befinden des Patienten stehen im Vordergrund der Behandlung.
Die Linderung des Leidens und die Unterstützung des Patienten stand auch früher schon im Zentrum der Aufgaben des Arztes, wie ein französisches Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert zusammenfasst: Guerir – quelquefois, soulager – souvant, consoler – toujours (Heilen – manchmal, lindern – oft, trösten – immer). In den Hospizen wurden Kranke und Bedürftige versorgt, und oft auch bis zum Tod begleitet. Mit der Entwicklung der modernen Medizin ist jedoch die Betreuung von Patienten mit fortgeschrittenen unheilbaren Erkrankungen zunehmend einseitiger geworden. Medizinische Maßnahmen werden oft noch angeboten, auch wenn nur noch winzige oder gar keine Erfolgsaussichten mehr bestehen, aber die Patienten oft mit ihren Symptomen und ihrer Angst vor Sterben und Tod alleine gelassen. Vor diesem Hintergrund wurde 1967 von Cicely Saunders in London das St.Christopher Hospiz gegründet, das die Keimzelle der modernen Palliativmedizin darstellt. Auch die erste deutsche Palliativstation, die 1982 an der Kölner Universitätsklinik entstanden ist, wurde stark vom St.Christopher Hospiz beeinflusst. Mittlerweile existieren mehr als 200 Palliativstationen und stationäre Hospize in Deutschland, allerdings ist der Bedarf damit bei weitem noch nicht gedeckt. Die wesentlichen Komponenten der Palliativmedizin sind Symptomkontrolle, psychosoziale Kompetenz, Teamarbeit und Sterbebegleitung.

Mehr als Schmerzen lindern
Gibt es Alternativen zur Sterbehilfe? Der Kölner Arzt Raymond Voltz über die Möglichkeiten und Grenzen der Palliativmedizin
aus DIE ZEIT vom 27.10.2005
DIE ZEIT: Sie haben als Palliativmediziner viele Menschen beim Sterben begleitet, denn Palliativmedizin setzt dort ein, wo kurative Medizin an ihre Grenzen stößt. Leistet Palliativmedizin denn hier nicht Sterbehilfe?
Raymond Voltz: Palliativmedizin leistet Hilfe im Sterbeprozess, sie leistet keine Hilfe zum Sterben. Wir helfen, wenn die Medizin im bisherigen Selbstverständnis nichts mehr für den Patienten tun kann. Ärzte verstehen sich traditionellerweise nur als Heiler. Wenn Heilen nicht mehr möglich ist, dann meinen sie, nichts mehr tun zu können. Genau dort setzt Palliativmedizin ein. Wir sagen: Wir können hier noch sehr viel tun, etwa wenn es darum geht, Symptome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit oder Verwirrtheit zu lindern. Manche dieser Beschwerden können sich vor dem Tod noch einmal deutlich verstärken, sodass wir sie dann auch sehr intensiv behandeln. Insofern könnte man sagen, dass wir im positiven Sinne verstandene Hilfe im oder beim Sterben leisten. Der Begriff wird in der öffentlichen Diskussion zu wenig differenziert und dadurch missverständlich verwendet. Palliativmedizin ist ein klares Gegenangebot zur aktiven Sterbehilfe.
ZEIT: Dennoch scheint die Unterstützung für Sterbehilfe in der Bevölkerung zu wachsen. Warum ist das so?
Voltz: Ich glaube, dass vielfach gar nicht klar ist, was aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe oder indirekte Sterbehilfe ist. Deshalb zweifele ich auch viele Umfragen zu diesem Thema an. Hinzu kommt, dass sich die Antworten entscheidend verändern, je nachdem, ob Sie gesunde oder erkrankte Menschen fragen. Wenn ein Mensch krank wird, ändert sich häufig schlagartig die Sichtweise. Betroffene äußern sehr viel weniger den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe. Wenn wir die Symptome, Schmerzen beispielsweise, bestmöglich gelindert haben, dann bleibt dem Patienten Raum und Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Er kann dann darüber nachdenken, was Lebensqualität für ihn bedeutet. Die Antwort hierauf ist sehr individuell, auch dort helfen wir. Neben dem Medizinisch-Pflegerischen bietet die Palliativmedizin auch Unterstützung bei notwendigen sozialen Maßnahmen. Wir kümmern uns um psychologische und seelsorgerische Begleitung, und zwar nicht nur für den Patienten selbst, sondern auch für seine Angehörigen.
ZEIT: Was Sie beschreiben, gilt vor allem für Krankheiten wie Krebs. Welche Möglichkeiten hat die Palliativmedizin bei selteneren Krankheiten, etwa dem so genannten Locked-in-Syndrom?
Voltz: Die Diskussion auf der Einzelfallebene ist immer schwierig, da man für jedes Argument einen anderen Einzelfall heranziehen kann. Das Locked-in-Syndrom ist kein klassisch palliativmedizinisches Krankheitsbild, aber sicherlich ein äußerst belastender Zustand. Locked-in bedeutet, dass man alles mitbekommt, wie im gesunden Zustand, aber nur sehr eingeschränkt nach außen kommunizieren kann, weil man bis auf die Augen vielleicht vollkommen gelähmt ist. Trotzdem müssen wir uns bemühen herauszufinden, was der Betroffene wünscht, und darauf eingehen. Außerdem ist es möglich, im Einverständnis mit den Betroffenen Komplikationen wie Thrombosen, Embolien oder Entzündungen nicht mehr ursächlich, sondern nur noch symptomorientiert zu behandeln. Dies könnte man als passive Sterbehilfe bezeichnen, und dies ist vollkommen legal.
ZEIT: Hat denn jeder Patient in Deutschland Zugang zur Palliativmedizin?
Voltz: Nein, bisher noch nicht. Es gibt Studien, die besagen, dass wir 50 bis 60 Betten pro eine Million Einwohner brauchten, um den Bedarf zu decken, der allein durch Krebserkrankungen entsteht. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Es gibt ebenfalls ein Versorgungsdefizit im ambulanten Bereich. Die Hausärzte werden bisher mit diesen Fällen allein gelassen. Deshalb versuchen wir, in Köln ein Netz für Palliativmedizin aufzubauen, damit sich die Hausärzte informieren können. So möchten wir auch erreichen, dass möglichst viele Patienten zu Hause bleiben können, denn das wünscht sich die Mehrheit der Betroffenen. Auch die Ausbildungssituation ist bislang unzureichend. Wir brauchen mehr Lehrstühle für Palliativmedizin an den Universitäten, damit mehr junge Mediziner ausgebildet werden können, und wir brauchen mehr Forschung, damit wir unsere Therapien besser auf die verschiedenen Krankheitsbilder ausrichten können.
ZEIT: Wie sollen neue stationäre und ambulante Angebote, mehr Lehrstühle und zusätzliche Forschung finanziert werden?
Voltz: Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat berechnet, dass eine flächendeckende und gute Palliativ- und Hospizarbeit 0,5 Prozent der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung betragen würde. Wenn man das mit anderen Bereichen vergleicht, glaube ich fest daran, dass wir durch eine effektivere Organisation anderer Bereiche und eine bessere Koordination zwischen ambulanten und stationären Strukturen in der Lage sind, Gelder so umzuschichten, dass wir auf diese 0,5 Prozent kommen.
Die Fragen stellte Isabell Hoffmann




